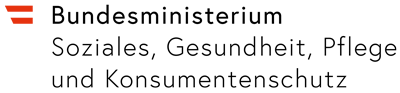Pedelecs – so die korrekte Bezeichnung – sind umweltfreundlich und bequem. Doch im Labor enttäuschten gleich mehrere renommierte Marken wegen gravierender Sicherheitsmängel.
Mehr als 100 Millionen Elektrofahrräder bevölkern die Straßen. Jährlich kommen 20 Millionen hinzu. Kein Gestank, kein Motorenlärm. Allerdings nur in China. Dort katapultierten viele Städte die Steuer auf Benzin-Zweitakter in astronomische Höhen und ebneten damit den Weg für die E-Bikes, die elektrischen Zweiräder.
In Österreich sind wir noch weit davon entfernt – wenngleich die EU als zweitgrößer Weltmarkt für das Fahren mit elektrischem Rückenwind gilt: Mit 1 Million verkauften E-Drahteseln wurde für 2010 gerechnet, 20.000 waren es laut VCÖ allein in Österreich. Das ist – allen Freudentänzen der Hersteller und des Handels zum Trotz – im Vergleich zu den herkömmlichen Fahrrädern (noch) nicht wirklich viel: Von diesen werden EU-weit jährlich rund 19 Millionen Stück verkauft und rund drei Viertel aller österreichischen Haushalte besitzen zumindest eines davon (Schlusslicht Wien mit nur 54 Prozent).
Viele Hügel, viel Bedarf
Für 2011 wird mit einer Verdoppelung des heimischen Absatzes von Elektrofahrrädern auf 40.000 Stück gerechnet. Österreich bietet sich aufgrund seiner hügeligen Topographie für diese Art der unterstützen Fortbewegung ja geradezu an.
Komfort- und Trekkingräder im Test
Ob da jeder Käufer reine Freude empfinden wird, muss angesichts der aktuellen Testergebnisse, die wir in Kooperation mit ADAC und Stiftung Warentest erarbeitet haben, freilich bezweifelt werden. Getestet wurden Komforträder (unisex) sowie Trekkingräder (Herrenmodelle). Vor allem schlecht funktionierende Bremsen, gebrochene Lenker und mangelnde Ausstattung führten zu einem unterm Strich nicht gerade erfreulichen Gesamteindruck: 2 "guten“ und 4 "durchschnittlichen" Ergebnissen stehen 3 "weniger zufriedenstellende" und 2 "nicht zufriedenstellende" Urteile gegenüber. (Lesen Sie auch E-Bikes - Sicherheitsschub.)
Gruppensieger Raleigh und Diamant
Leider finden sich auch die bekannten Marken KTM und Kettler unter den Gestrauchelten. Die Gruppensieger Raleigh und Diamant werden leider eher nur von kleineren Händlern angeboten (Händlerlisten sind auf fast allen Hersteller-Websites einzusehen, siehe "Anbieter“).