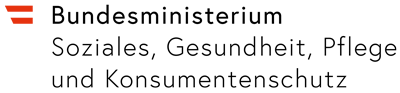Arbeitsbedingungen wie in den Niedriglohnländern Südostasiens, mitten in Europa? Im Industrieviertel Macrolotto in der Toskana wird Kleidung made in Italy hergestellt – von chinesischen Arbeitern.
 |
Macrolotto am Rande von Prato: Hunderte Fabrikhallen reihen sich hier Seite an Seite. Über den Eingängen liest man italienische Firmennamen, gleich darunter chinesische Schriftzeichen.
Das Industrieviertel Macrolotto in Prato war ursprünglich Kerngebiet der italienischen Stoff- und Bekleidungsproduktion. Doch mit der Verlagerung der europäischen Textilproduktion nach China warben italienische Industrielle in den 1990er-Jahren Chinesen als billige Textilarbeiter für Prato an, später wurden die Fabriken von Chinesen übernommen.
Modebetriebe in chinesischer Hand
Im Jahr 2014 waren bereits 19 Prozent der Textilunternehmen und 22 Prozent der Leder- und Schuhwaren in der Toskana in chinesischer Hand. In Prato und Umgebung sind heute rund 3.600 chinesische Textilbetriebe ansässig. Von rund 190.000 Einwohnern sind 34.000 Migranten, knapp die Hälfte von ihnen kommt aus China – laut offizieller Statistik. Die Zahl der nicht angemeldeten Einwanderer ist allerdings weit höher.
"Made-in-Italy" von chinesischen Arbeitern ...
Die chinesischen Einwanderer nähten zu Beginn für italienische Produzenten – billig, und fast immer illegal. Doch dann kam die Krise: Pratos Stoffe waren auf dem internationalen Markt nicht mehr konkurrenzfähig, eine Firma nach der anderen musste schließen. Die Stadt verlor um die Jahrtausendwende nahezu die Hälfte ihrer Unternehmen. Die Chinesen zogen in die leeren Industriehallen ein, die italienische Industrielle ihnen zu hohen Preisen vermieteten oder verkauften, und begründeten einen neuen Wirtschaftszweig: die "Pronto Moda".
... mit chinesischen Stoffen
Auf Abruf werden innerhalb kürzester Zeit große Mengen an Kleidungsstücken in billiger Qualität hergestellt. Manche der chinesischen Einwanderer gründeten eigene Unternehmen, die Stoffe werden aus der Heimat importiert. Trotzdem bekommen die Kleider das international begehrte Made-in-Italy-Label.