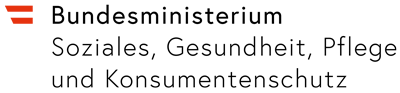Konsument Startseite
Weitere aktuelle Artikel

Sneaker im Test: Puma, Adidas, On, Nike
Das Schweizer Konsumentenmagazin K-Tipp hat Sneaker getestet. Viele schicke Marken schnitten schlecht ab.

Bügeleisen-Test 2024: Vergleich Tefal und Braun
Wie gründlich glätten Dampfbügeleisen Falten auf Textilien?

Genormte Mehrwegflasche: Ein Prost aufs Wiederverwenden
Unser Nachhaltigkeits-Redakteur Markus Stingl vermisst das kleine Bier in der Mehrwegflasche schon lange. Jetzt gib es sie endlich: Eine österreichweite Branchenlösung für 0,33er-Mehrwegflaschen. Lesen Sie mehr im VKI-Blog.
Alle PREMIUM-Artikel auf konsument.at lesen
KONSUMENT: Unabhängig und objektiv

Warum Sie dem VKI vertrauen können
Gekaufte Umfragen, mangelnde Distanz zwischen Medien und Politik? Die Vorwürfe und Enthüllungen reißen nicht ab. Uns vom VKI können Sie vertrauen.

Wer wir sind
Beraten, informieren, testen: Wir sorgen für mehr Gerechtigkeit, höhere Qualität und geringere Ausgaben.

So testen wir
Heutzutage ist es einfach, an sogenannte „Testergebnisse“ heranzukommen. Bei uns steckt wirklich ein Test dahinter.
Streaming: Die EURO 2024 via DreiTV oder SimpliTV
Es genügt ein Internetzugang in Verbindung mit einer App, um auf dem Smart-TV alle Spiele der EURO 2024 verfolgen zu können. DreiTV und SimpliTV sind hier zwei Optionen. Wir haben uns angesehen, was sie kosten und was sie bieten.
TESTS

Veganer Käse im Test: Welcher ist der gesündeste?
Wir haben 162 vegane Käsealternativen auf ihre Nährwerte, den Grad der industriellen Verarbeitung sowie Aufmachung und Kennzeichnung auf der Verpackung hin überprüft.

Medikamente: Ibumetin Filmtabletten - bei Schmerzen
Wie gut eignen sich rezeptfreie Medikamente? Wir überprüfen dazu regelmäßig Arzneimittel. Diesmal im Test: Ibumetin Filmtabletten.

Test: Sonnenschutz für das Gesicht
Wir haben 13 Sonnenschutzcremes fürs Gesicht getestet. Welches sind die besten und welche versagen beim UV-Schutz?

Nahrungsergänzungsmittel für Gelenke: Kein Nutzen
Mittel für Knochen und Knorpel sollen bei Gelenksbeschwerden helfen. Doch die Beweislage ist dürftig und manche Präparate sind riskant für die Gesundheit. Bewegung und gutes Essen sind besser.

Medikamente: Calmaben Dragees - bei Schlafstörungen
Wie gut eignen sich rezeptfreie Medikamente? Wir überprüfen dazu regelmäßig Arzneimittel. Diesmal im Test: Calmaben Dragees.

Mikrowellen-Reiskocher im Schnelltest: Welcher ist der Beste?
Kochen Sie Reis im Topf auf dem Herd? Wer eine andere Methode ausprobieren will, stößt auf Mikrowellen-Reiskocher. Wir haben drei Geräte getestet.
REPORTS

Gold kaufen - Edelmetall als Anlage
Gerade in Krisenzeiten setzen viele auf Gold. Einen kleinen Teil des Vermögens in Edelmetall anzulegen, kann sinnvoll sein. Der Kauf ist aber vor allem eine Vertrauenssache.

EURO 2024: Tipps für Anreise und Unterkunft
Berlin, Köln, München, … In 10 deutschen Städten finden die Spiele statt. So reisen Sie günstig an. Das müssen Sie wissen, um Ärger zu vermeiden.

Wie sinnvoll sind IgG-Tests?
Hilft ein IgG-Antikörpertest dabei, Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu entdecken? Bessern sich Gesundheitsprobleme, wenn man nach einem auffälligen IgG-Testergebnis auf betroffene Nahrungsmittel verzichtet?

Ungenügende Schmerztherapie: Ausweitung gefordert
Etwa jeder fünfte Mensch in Österreich leidet an einer chronischen Schmerzerkrankung. Das bedeutet großes Leid und existenzielle Sorgen. Die Patientenanwaltschaften fordern einen Ausbau der Schmerzversorgung.

Krebsversicherung: Sinnvoll im Ernstfall?
Die Krebsversicherung ist ein auf den ersten Blick recht simples Produkt. Die Tücken stecken jedoch im Detail. Wie notwendig ist diese Versicherung?

Jugendgetränke - Wie gesund sind Energydrinks?
Influencer:innen sorgen für Hypes um Limonaden und Energy Drinks für Kinder und Jugendliche. Manche der Produkte sind aufgrund ihres hohen Koffeingehalts gerade für die Zielgruppe allerdings alles andere als gesund.
LEBENSMITTEL-CHECK

Manner Mozart Mignon Schnitten: Verpackung verkleinert
Manner hat die Verpackung ihrer "Mozart"-Schnitten nochmals überarbeitet: die Packung mit der Kennzeichnung der geringen Füllhöhe wurde durch eine neue verkleinerte Version ersetzt und passt jetzt besser zur Füllmenge.

Spar Roll Fondant rot: nicht "vegan"
Der Tortenüberzug "Roll Fondant rot" wird von Spar als "vegan" ausgelobt, enthält aber "Echtes Karmin". Dieser Farbstoff stammt aus Schildläusen und ist somit nicht vegan.

Søstrene Grene Vanilla Fudge: "Luxury" gestrichen
Der Hersteller hat die Bezeichnung "Luxury" von der Verpackung entfernt. Gut so, denn eine Süßigkeit aus Zucker und Palmöl hat nichts Luxuriöses an sich.