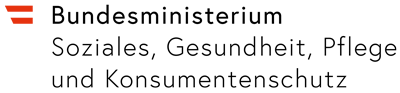Nebenwirkungen: spät erkannt
Neue Arzneimittel erhalten ihre Zulassung in der Regel, nachdem
sie an 2000 bis 4000 Patienten erfolgreich erprobt worden sind. Diese Zahl
reicht aber bei weitem nicht aus, um seltene Nebenwirkungen zu erkennen. Sie
werden erst in den folgenden Jahren entdeckt, in denen das Mittel beim breiten
Publikum unter Alltagsbedingungen angewandt wird. Für diese
„Anwendungsbeobachtung“ sind Ärzte und Apotheker gesetzlich verpflichtet, bisher
unbekannte Effekte zu melden, von denen sie annehmen, dass das Medikament sie
verursacht hat. Die Meldefreudigkeit ist zwar beklagenswert gering, doch
letztlich kommen so weitere Informationen zusammen, die das Profil des
Wirkstoffs vor allem hinsichtlich seiner Sicherheit bei Langzeitanwendung klarer
beleuchten. Eine besonders schwere unerwünschte Wirkung des Schmerzmittels
Metamizol zum Beispiel, eine lebensgefährliche Störung der Blutbildung, tritt
mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu einer Million auf. Um sicher zu wissen,
dass Störung und Medikament zusammenhängen, müssen statistische Daten über die
Behandlung von drei Millionen Menschen vorliegen.2)
Pharmakritiker nennen dieses Vorgehen „unkontrollierter Großversuch von
Arzneimitteln an der nicht informierten Bevölkerung“, denn zu groß angelegten,
wissenschaftlich fundierten Anwendungsbeobachtungen, deren Ergebnisse selbst bei
negativem Ausgang für das Produkt veröffentlicht werden, sind die
pharmazeutischen Unternehmer nicht verpflichtet.3) Darum fordern Kritiker schon seit langem, dass
spezielle Prüfinstitute geschaffen werden, die diese Arbeit übernehmen. Bisher
sind das jedoch nur Wünsche.
Wer noch nicht krank ist, wird es spätestens, wenn er den Beipackzettel
seines Medikamentes liest. Dessen Text dient vielem – dass er aber, wie vom
Gesetz vorgesehen, die Sicherheit der Anwendung von Arzneimitteln erhöht, ist
Illusion. Eine deutsche Krankenkasse hat ihre Mitglieder befragt, wie gut sie
die Beipackzettel ihrer Medikamente verstehen. 43 Prozent haben Probleme damit;
fast ein Drittel greift zunächst einmal zum Lexikon. Fast ein weiteres Drittel
will sich den Frust gar nicht erst antun und wirft das Papier in den Mistkübel.
Das wird bei uns in Österreich wohl nicht anders sein.
Problemfall Beipackzettel
Das Gesetz schreibt vor, was das Papier enthalten muss, und die Hersteller
tun gut daran, sich daran zu halten, wenn sie sich nicht auf juridische
Abenteuer einlassen wollen. So kann es zum Beispiel erhebliche
haftungsrechtliche Konsequenzen haben, wenn sie von einer möglichen
unerwünschten Wirkung wissen, sie im Beipackzettel aber nicht aufführen.
Ähnliches gilt für die Anwendungsgebiete. Nur für das, wofür das Mittel in den
klinischen Prüfungen untersucht wurde, kann es zugelassen werden. Und nur für
die Anwendung bei diesen Indikationen kann der Hersteller haftbar gemacht
werden, wenn trotz bestimmungsgemäßen Gebrauchs etwas schief geht. Es heißt
nicht, dass das Mittel bei anderen als den genannten Indikationen nicht
wirkt.
Gebrauchsinformation beachten
An dem Beispiel eines Schmerzmittels mit dem Wirkstoff Ibuprofen
sei das illustriert. Ein Arzt hat einer Frau ein Präparat mit 200 mg Ibuprofen
gegen ihre Regelschmerzen verordnet. Nun kommt sie mit Gelenkschmerzen. Auch
dagegen wird Ibuprofen eingesetzt, allerdings in höherer Dosierung. Wenn er ihr
nun empfiehlt, von dem Mittel gegen Regelschmerzen eine größere Menge
einzunehmen und damit ihre Gelenkschmerzen zu lindern, trägt er das volle Risiko
für diesen Rat, wenn die Gebrauchsinformation des Herstellers die Indikation
„entzündliches Rheuma, Gelenkschmerzen“ nicht aufführt. Die Schmerzen lindert es
aber auch ohne die entsprechende Angabe.
Bleibt noch eine interessante Frage
offen: Nehmen wir eigentlich all das ein, was wir von unseren Ärzten
verschrieben bekommen? Auch das haben unsere gründlichen deutschen Nachbarn
erhoben. Unglaubliche 4500 Tonnen Medikamente werfen die Bundes- deutschen
jährlich weg.4) Experten befürchten, dass die Situation in
Österreich nicht viel anders ist.
1) Wunderdroge sucht passende Krankheit; Süddeutsche
Zeitung 271, 24. 11. 1998
2) Deutsche Apotheker Zeitung 137, 50,
11. 12. 1997, S. 30
3) BÄK-Intern; 29. 4. 1998, S.
14
4)
Deutsche Apotheker Zeitung 139, 4, 28. 1. 1999, S. 8