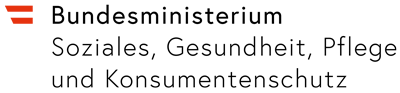Ohne Röntgendiagnostik ist die Medizin heute nicht mehr vorstellbar. Doch nicht immer sind die Untersuchungen notwendig. Experten warnen vor möglichen Gefahren.
Zweifellos hat die Entdeckung, die der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen 1895 machte, die medizinische Diagnostik – und auch die Therapie – entscheidend vorangetrieben. Mithilfe der von Röntgen entdeckten elektromagnetischen (ionisierenden) X-Strahlen wurde der Traum der Ärzte wahr, in den Körper eines Menschen sehen zu können, ohne ihn aufschneiden zu müssen.
Fortschritt für die Medizin
80 Jahre später wurde das bildgebende Verfahren weiterentwickelt zur Computertomographie (CT) – zu Röntgen-Schichtbildern, die auch dreidimensionale Darstellungen ermöglichen. So können in kürzester Zeit die Ursachen von Beschwerden oder Krankheiten und die Folgen von Unfällen aufgespürt werden. Ein ganzes Herz inklusive der Herzkranzgefäße erscheint heute innerhalb von Sekunden als dreidimensionales Bild. Doch das bildgebende Verfahren hat nicht nur Vorteile.
Gefahren durch die Strahlung
Dass zu Diagnosezwecken eingesetzte radioaktive Strahlen dem menschlichen Körper auch schaden, ist keine Neuigkeit. Nicht wenige Radiologen der Pionierzeit wurden Opfer ihres Berufes, weil sie stundenlang und ohne jeden Schutz an der Röntgenröhre standen. Sie starben an Verbrennungen, an sogenannten Röntgengeschwüren, nicht heilenden Wunden, an Bluterkrankungen oder an Krebs.
Freilich sind diese Zeiten längst vorbei, und heute weiß man, dass vor allem Zellen von unausgereiftem Gewebe strahlenempfindlich sind. Für Schwangere gelten deshalb wegen der Gefahr für das Ungeborene besondere Vorsichtsmaßnahmen. Hier muss es im Vorfeld eines Röntgens zu einer sorgfältigen Nutzen-Risiko-Abwägung kommen.