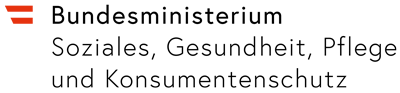KONSUMENT: Herr Professor Schneider, finden Sie Schwarzarbeit eigentlich verwerflich?
Schneider: Nein, per se finde ich Schwarzarbeit nicht verwerflich. Sie ist ein Bestandteil unseres Lebens. Es gibt ganze Bereiche, die wir fast komplett in die Schwarzarbeit ausgelagert haben. In 90 Prozent aller österreichischen Haushalte arbeitet die Putzkraft schwarz. Wahrscheinlich sind’s sogar mehr. Sehr lange war’s auch die Nachhilfestunde. Jetzt gibt’s mehr und mehr organisierte Lernhilfen, die das professionell machen. Jedes 2. Einfamilienhaus, zumindest hier in Oberösterreich, gäbe es ohne den Pfusch nicht. Weil wenn man alles, vom ersten Spatenstich bis zum letzten Pinselstrich, mit Rechnung macht, kann man sich das nicht leisten.
Alles bestens also?
Provokant kann man es so formulieren: Der Pfusch erhöht unseren Wohlstand. Aber es gibt natürlich auch Verlierer. Der größte ist der Staat, und hier wahrscheinlich die Sozialversicherungsträger. Ihnen fehlen durch den Pfusch Beitragseinnahmen. Dem Staat fehlen Steuereinnahmen. Wobei hier die Geschichte etwas komplizierter ist. Weil das im Pfusch verdiente Geld meistens sofort wieder ausgegeben wird, sodass zumindest die Mehrwertsteuer bzw. andere Verbrauchssteuern fällig werden.
Wo liegen die Grenzen von Schwarzarbeit? Die Nachhilfestunde, die ein Mathematik-Student einem Schulkind gibt – ist das schon illegal?
Schwarzarbeit beginnt dort, wo man steuerpflichtig ist. Wenn man’s im beschränkten Umfang macht, ist es nicht steuerpflichtig. Sozialversicherungspflichtig aber relativ rasch, doch es gibt gewisse Freigrenzen. Wenn der Student nur 200, 300 Euro damit verdient und er macht sonst keine andere Arbeit, dann ist das wohl nicht steuerpflichtig. Aber ich bin kein Steuerjurist. Es gibt aber auch legalisierten Pfusch – zum Beispiel ein Baumarkt-Mitarbeiter, der mir das Angebot unterbreitet: „Die Keramikdichtung für die Dusche, die Sie da kaufen wollen, die kann ich Ihnen gerne nach Feierabend einbauen." Das darf er machen. Das fällt unter Freundschaftsdienst.