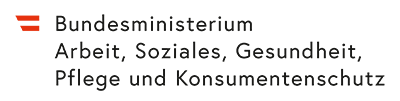Sicher und rentabel
Der Deckungsstock muss als Sondervermögen aufgebaut und getrennt vom übrigen Vermögen der Versicherer verwaltet werden. Dafür gibt es klare gesetzliche Spielregeln, überwacht von der Finanzmarktaufsicht (FMA). Gespeist wird der Deckungsstock von den Kundengeldern, also den Einzahlungen in Lebensversicherung & Co (abzüglich der bekannt hohen Kosten und abzüglich der Steuer). Die Gelder können von den Versicherern nicht x-beliebig angelegt werden, einen gewissen Spielraum haben sie aber schon (siehe Grafik). Die Quadratur des Kreises lautet dabei: so sicher wie nötig und gleichzeitig so rentabel wie möglich.
Kapitalgarantie und Gewinnbeteiligung
Der Deckungsstock kommt aber noch andernorts zum Tragen. Bei Garantieprodukten wie etwa der klassischen Lebensversicherung werden Kapitalgarantien über den Deckungsstock abgesichert. Auch Gewinnbeteiligungen von Kapitallebensversicherungen ergeben sich aus dem Ver- anlagungserfolg im Deckungsstock. Dieser Veranlagungserfolg ist aber gelinde gesagt ziemlich mau. Der zuvor erwähnte Spagat zwischen Sicherheit und Rentabilität kann nicht gelingen. Das Kapital im Deckungsstock wird zumeist in (festverzinsliche) Anleihen, Pfandbriefe, Hypotheken, Grundstücke, Schuldverschreibungen und andere relativ sichere („konservative“) Anlagen investiert.
Der Aktienanteil, der ein wenig Schwung in die Sache bringen könnte, ist gering (5 bis 7 Prozent im Durchschnitt). Das Resultat, auf das wir in der Vergangenheit schon mehrfach hingewiesen haben: Klassische Lebensversicherungen schaffen es nicht einmal, die Inflation zu schlagen, also den Wert des eingezahlten Geldes langfristig zu erhalten. Hinzu kommt, dass im aktuellen Markt- und Wirtschaftsumfeld sogar Veranlagungskategorien, die in der Vergangenheit als sicher eingestuft wurden (wie z.B. Staatsanleihen), diesen Nimbus nach und nach einbüßen. Das führt dazu, dass man auch das „Ausfallsrisiko“ von klassischen Lebensversicherungen nicht mehr ganz ausschließen kann.
Wer zahlt die Zeche?
Zurück zum Geldauffangbecken. Wer genauer hinschaut, findet im § 316 des Versicherungsaufsichtsgesetzes interessante Formulierungen, die aus Sicht der Versicherten wenig erbaulich klingen. Die FMA kann demnach auf vertraglich garantierte Leistungen Einfluss nehmen. Dann, wenn „die Vermeidung eines Konkurses im Interesse der Versicherten gelegen ist“ – wer auch immer das genau zu entscheiden hat. Im Klartext: Zahlungen – insbesondere Versiche- rungsleistungen, in der Lebensversicherung auch Rückkäufe und Vorauszahlungen auf Polizzen – können seitens der FMA untersagt bzw. Verpflichtungen des Versicherers aus der Lebensversicherung herabgesetzt (= es wird weniger ausgezahlt) werden.
Auf der anderen Seite müssen die Kunden weiter brav ihre Prämienzahlungen leisten. Bei dieser Hintertür darf man berechtigterweise fragen, wer am Ende des Tages die Zeche zahlen müsste, wenn ein (Lebens-)Versicherer in Schieflage gerät.
Phönix-Versicherung
Freilich, in Österreich hat es mit der Phönix-Versicherung nur einmal einen Versicherer „aufgestellt“ – und das war vor mehr als 80 Jahren. Ausgeschlossen sind Insolvenzen von (Lebens-)Versicherern, gerade im aktuellen Niedrigzinsumfeld, allerdings nicht (siehe beispielsweise Japan, wo das schon lange vorherrschende extrem niedrige Zinsniveau einige Opfer in der Branche gefordert hat).